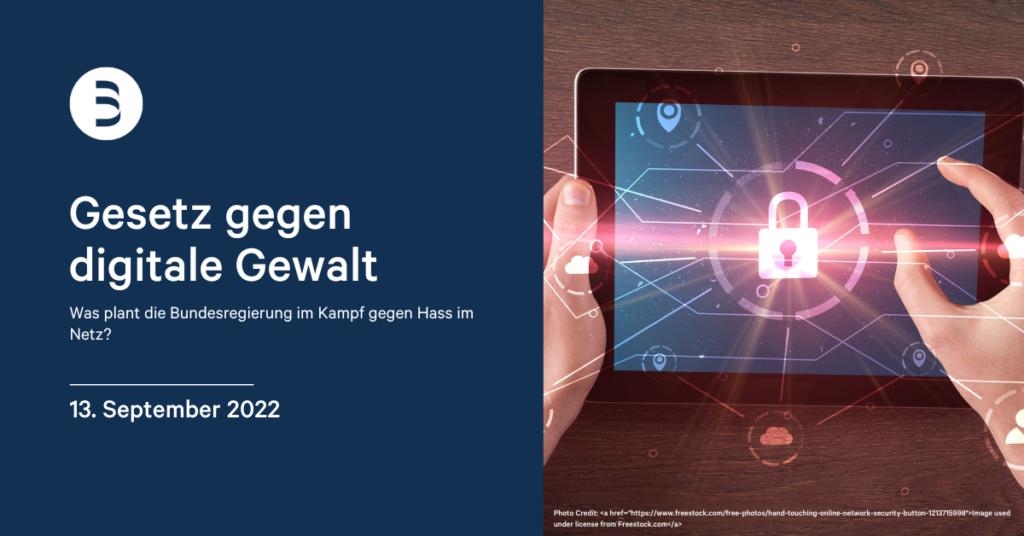
Vor zwei Wochen hat die Bundesregierung ihre lange erwartete Digitalstrategie beschlossen. Darin wird unter anderem ein Vorhaben konkretisiert, das bereits im Koalitionsvertrag zu finden war: Mit einem „Gesetz gegen digitale Gewalt“ soll künftig konsequenter gegen Hass und Hetze im Netz, insbesondere in sozialen Netzwerken, vorgegangen werden. So sollen mit dem Gesetz „rechtliche Hürden für Betroffene“ sowie „Lücken bei Auskunftsrechten“ abgebaut werden. Außerdem sollen „die rechtlichen Rahmenbedingungen für elektronische Verfahren zur Anzeigenerstattung“ geschaffen sowie „richterlich angeordnete Accountsperren“ ermöglicht werden. Insbesondere letzteres würde den Fokus weg von den Plattformen selbst hin zu den Betroffenen digitaler Gewalt lenken. Gerichte könnten Twitter und Co. künftig das Löschen von Accounts vorschreiben, denen von Nutzer*innen die Verbreitung von digitaler Gewalt vorgeworfen wird.
Der DSA sieht v.a. Plattformen in der Verantwortung
In Deutschland dient bislang das 2017 eingeführte Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) zur Bekämpfung von Hasskriminalität und anderer strafbarer Inhalte im Netz. Das NetzDG sieht unter anderem konkrete Löschfristen und Meldepflichten verdächtiger Inhalte an das Bundeskriminalamt (BKA) vor, die aufgrund von Klagen zahlreicher Plattformen, wie Facebook, Google, YouTube und TikTok, aktuell ausgesetzt sind. Laut der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion werde das NetzDG jedoch weitgehend durch den Digital Services Act (DSA) ersetzt, aufgrund seiner „vollharmonisierenden Wirkung“.
Der DSA gilt ab 17. Februar 2024, für besonders große Plattformen mit monatlich mehr als 45 Millionen Nutzer*innen werden die darin formulierten rechtlichen Anforderungen teilweise schon früher wirksam. Laut DSA müssen Betreiber sozialer Netzwerke und Plattformen umfangreiche Kontakt- und Beschwerdemöglichkeiten anbieten, um es Nutzer*innen zu ermöglichen, Beleidigungen und Drohungen direkter und schneller zu melden. Konkrete Löschfristen sowie Meldepflichten an Justiz- und Strafverfolgungsbehörden sieht der DSA im Gegensatz zum deutschen NetzDG nicht vor. Auch richterlich angeordnete Accountsperren sind im DSA nicht vorgesehen. Statt bei den Gerichten sieht der DSA hier die Verantwortung bei den Plattformen selbst: So heißt es in Artikel 23 Abs. 1, dass die Anbieter von Online-Plattformen „die Erbringung ihrer Dienste für Nutzer, die häufig und offensichtlich rechtswidrige Inhalte bereitstellen, für einen angemessenen Zeitraum nach vorheriger Warnung“ aussetzen müssen. Mit dem Gesetz gegen digitale Gewalt plant die Bundesregierung nun, über die DSA-Vorgaben hinauszugehen, wie sie in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion verlauten ließ: Das Anliegen, richterlich angeordnete Accountsperren zu ermöglichen, habe keine Berücksichtigung im DSA gefunden, weil dessen allgemeine Ausrichtung „bereits vor Veröffentlichung des Koalitionsvertrags abgeschlossen“ gewesen sei. Die Bundesregierung wolle deshalb prüfen, „inwieweit richterlich angeordnete Accountsperren im nationalen Recht umgesetzt werden können.“
Die Ampel will die private Rechtsdurchsetzung für Betroffene stärken
Im Gegensatz zu den bislang zur Verfügung stehenden Mitteln, wie Strafverfahren oder der Löschung illegaler Inhalte durch die Plattformen selbst, soll mit dem Gesetz gegen digitale Gewalt ein Instrument geschaffen werden, das die private Rechtsdurchsetzung stärkt. Betroffene digitaler Gewalt hätten somit künftig das Recht, im Rahmen zivilrechtlicher Verfahren Sperren von Accounts, von denen digitale Gewalt ausgeht, schnell und effektiv durchzusetzen.
Laut ihrer Digitalstrategie will sich die Bundesregierung bis 2025 daran messen lassen, ob „das Gesetz gegen digitale Gewalt und die entsprechenden Beratungsangebote den Betroffenen wirksame Unterstützung bieten, um sich gegen digitale Gewalt zu wehren.“ Nach einer umfassenden rechtlichen Prüfung wird das für die Umsetzung des Gesetzes zuständige Bundesministerium für Justiz (BMJ) schon bald einen ersten Referentenentwurf erarbeiten. Eine Positionierung potenziell betroffener Stakeholder zu dem Vorhaben der Bundesregierung sollte daher bereits jetzt erfolgen, um frühzeitig Einfluss auf die politische Debatte und den Erarbeitungsprozess nehmen zu können.