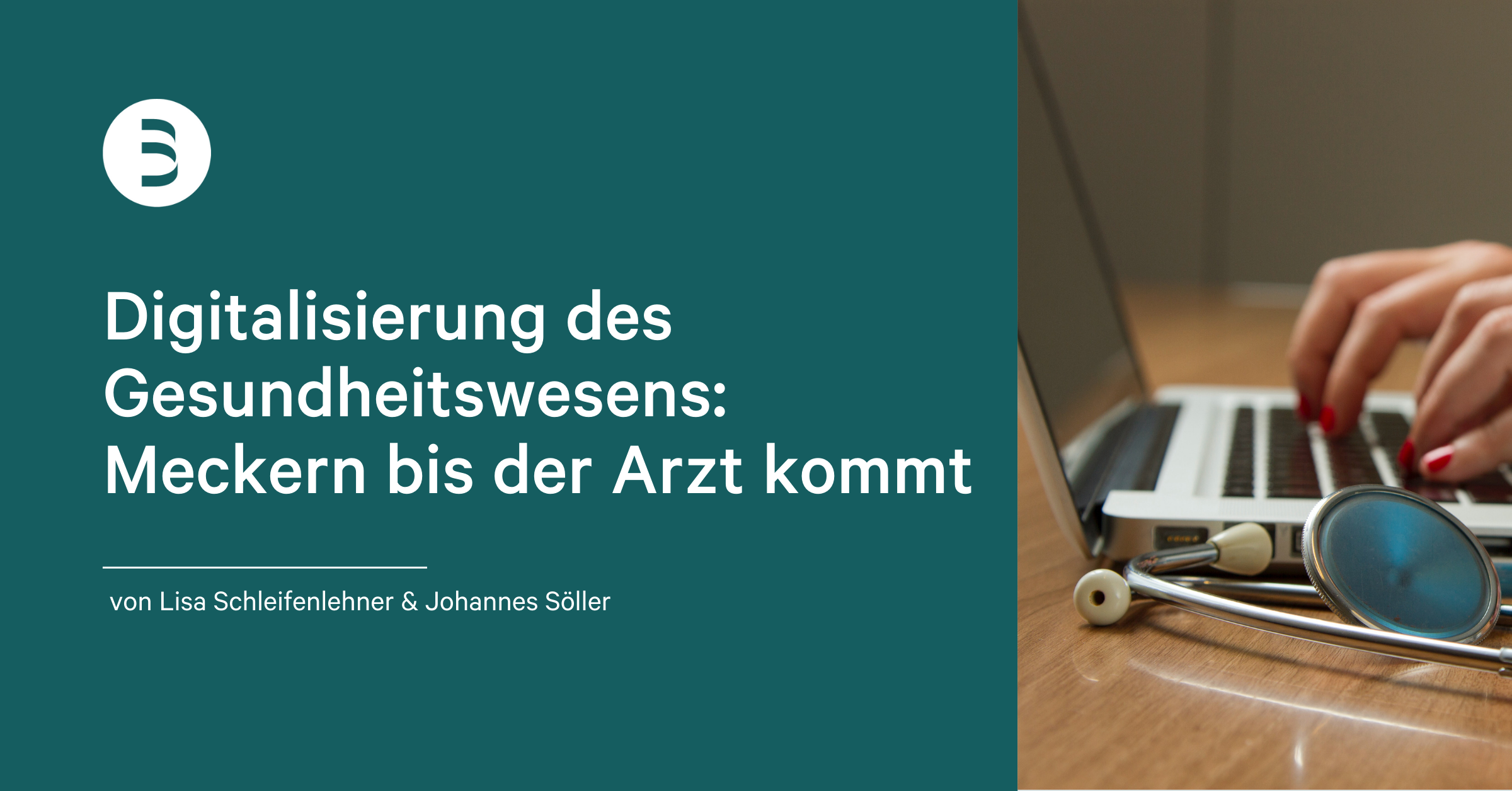
Warum die Pauschalkritik an der Digitalisierung der Gesundheitsversorgung zu kurz greift
Sie ist in den vergangenen Jahren schon so etwas wie ein Volkssport geworden, die Kritik an der langsamen Entwicklung der Digitalisierung im Gesundheitswesen in Deutschland. Reflexartig wird der Politik Untätigkeit vorgeworfen, während Leistungserbringer in anderen Ländern offenbar schon komplett im virtuellen Raum zu arbeiten scheinen. Gerade mit Einsetzen der Corona-Pandemie wurde das ohnehin inflationär gebrauchte Bild vom Virus als Brennglas für die Probleme der Gesellschaft auch gerne mit Blick auf das angeblich in der analogen Steinzeit befindliche Gesundheitswesen bemüht. Auch wenn man es den zuständigen Entscheidungsträgern durchaus vorwerfen kann, dass Deutschland in vielerlei Hinsicht bei der Digitalisierung hinterherhinkt – nicht nur in der Gesundheitsversorgung – so greift die Kritik doch in ihrer Pauschalität zu kurz und vernachlässigt wichtige Entwicklungen hin zu einer digitalen Gesellschaft.
Die häufig gemachte Generalabrechnung mit der digitalen Gesundheitspolitik blendet dabei nicht nur wichtige Erfolge aus, sondern verschleiert auch den Blick auf die noch offenen Baustellen. Dies trübt einerseits die Akzeptanz für die umgesetzten Lösungen und erschwert andererseits eine klare Eingrenzung des noch bestehenden regulatorischen Handlungsbedarfs. Bei aller berechtigten Kritik an der Geschwindigkeit, mit der das Thema politisch vorangetrieben wird, lohnt daher ein genauer Blick darauf, was überhaupt kritisiert wird und in inwieweit eine Pauschalkritik zu kurz greift.
Im Koalitionsvertrag von Anfang 2018 haben sich CDU/CSU und SPD ambitionierte Ziele zur Digitalisierung des Gesundheitswesens gesetzt und diese auch größtenteils erfolgreich umgesetzt. Allein drei explizit der Digitalisierung gewidmete Gesetzgebungsvorhaben hat das Bundesgesundheitsministerium unter Jens Spahn in der auslaufenden Legislaturperiode auf den Weg gebracht. Das Digitale-Versorgung-Gesetz wurde 2019 verabschiedet und ermöglicht es unter anderem, dass Ärzte digitale Gesundheitsanwendungen verschreiben und Krankenkassen diese erstatten können. Mit dem 2020 verabschiedeten Patientendatenschutzgesetz wurden wichtige Grundlagen zur Einführung der elektronischen Patientenakte und des E-Rezepts gelegt. Und noch vor Ende der laufenden Legislaturperiode sollen mit dem Digitale Versorgung und Pflege – Modernisierungs-Gesetz (DVPMG) die bestehenden Möglichkeiten ausgebaut und sinnvoll ergänzt werden. Am Freitag (5. März) befasst sich der Bundesrat in erster Lesung mit dem entsprechenden Gesetzentwurf der Bundesregierung.
Nun kann man darüber schmunzeln, dass beim E-Rezept zu Beginn weiterhin die Möglichkeit bestehen soll, sich die Verordnung vom Arzt ausdrucken zu lassen oder dass die elektronische Patientenakte zunächst nur mit PDF-Dateien befüllt werden kann. Doch darf man dabei nicht vergessen, dass beide Lösungen erheblich zur Verbesserung der Versorgung und zur Mündigkeit der Patienten beitragen werden. Kinderkrankheiten hat es bislang noch bei nahezu jeder neuen Regulierung gegeben.
Mit dem DVPMG dreht die Bundesregierung an entscheidenden Stellschrauben zur Feinjustierung der digitalen Gesundheitsversorgung. Sie führt digitale Pflegeanwendungen ein, die von der Pflegeversicherung erstattet werden können, baut die Telemedizin weiter aus und erweitert bestehende Regelungen bei den digitalen Gesundheitsanwendungen, der elektronischen Patientenakte und der Telematikinfrastruktur. Dennoch lässt sich berechtigte Kritik an einzelnen Teilen des Gesetzentwurfs äußern, etwa hinsichtlich der Leistungsbegrenzung bei Videosprechstunden oder der Nutzerfreundlichkeit der ePA. Außerdem fehlen weiterhin belastbare Regelungen zum Austausch klinischer Daten, etwa zwischen ePA und DIGAs oder zu Forschungszwecken.
Ein tieferliegendes Problem, das in der Debatte oft ein wenig untergeht, ist der mangelhafte Ausbau digitaler Infrastruktur in Deutschland. Letztlich bringt ein optimaler regulatorischer Rahmen für digitale Versorgung wenig, wenn der dafür nötige Breitbandausbau dort stockt, wo er am dringendsten benötigt wird: In den Gegenden, die aufgrund ihrer Abgeschiedenheit von Telemedizin und Arzneimittelversand am meisten profitieren würden. Auch die nahezu dogmatische Verehrung des Datenschutzes steht dem technischen Fortschritt hierzulande nicht nur in der Gesundheitsversorgung häufig im Weg. Es ist durchaus beachtlich, dass die notorisch datenschutzhörigen Deutschen die Einführung der Corona-Warn-App vergangenes Jahr verhältnismäßig geräuschlos begleitet haben.
Das DVPMG ist zwar das letzte Digitalisierungsgesetz, das unter Gesundheitsminister Jens Spahn auf den Weg gebracht wurde. Die Digitalisierung wird jedoch in der kommenden Legislaturperiode eine zentrale Aufgabe der Gesundheitspolitik bleiben. Solange das Patientenwohl die maßgebliche Leitlinie bei der Gestaltung und Umsetzung entsprechender Rahmenbedingungen bleibt, kann die Digitalisierung des Gesundheitswesens zur Erfolgsgeschichte werden. Sobald auch in der Fläche die technischen Grundlagen bestehen, um digitale Versorgungsleistungen anbieten zu können, sollte auch die Akzeptanz steigen und die gefühlte digitale Rückständigkeit abnehmen.
Übrigens: Mit dem Gesetzentwurf zum DVPMG hat sich auch der Verband Digitale Gesundheit (VdigG) ausführlich auseinandergesetzt. Bernstein Health-Beraterin Lisa Schleifenlehner war maßgeblich an der Formulierung der VdigG-Stellungnahme beteiligt. Sie finden die Stellungnahme hier: Stellungnahme VdigG.